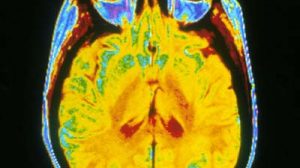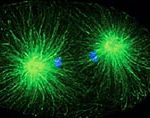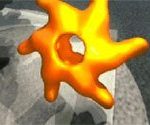An Legasthenie leiden in Europa rund 22 Millionen Menschen. Nicht lesen und schreiben zu können, trotz Schulbesuch und viel Unterstützung durch die Eltern, belastet viele Kinder in ihrer Entwicklung. Deutsche Forscher haben nun erstmals ein Gen gefunden, das wesentlich die Regulation eines Glukosetransporters im Gehirn steuert und die Sprachverarbeitung bei Kindern mit Legasthenie beeinflusst. Sie stellen ihre neuen Ergebnisse in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift „Molecular Psychiatry“ vor.
{1r}
„Dies ist ein Durchbruch in der Legasthenieforschung, da wir hiermit erstmals eine mögliche Ursache der Legasthenie entdeckt haben. Bereits bei Babies, die ein erhöhtes Risiko für Legasthenie haben, finden sich Veränderungen bei der Sprachwahrnehmung“, sagt Professor Gerd Schulte-Körne. „ Nun können wir zeigen, dass die Regulation des Gens SLC2A3 eine zentrale Rolle für die Gehirnfunktionen bei der Legasthenie spielt. Wenn die Funktion dieses Gens beeinträchtigt ist, so finden wir auch im Gehirn eine schwächere Reaktion der Nervenzellen bei der Sprachverarbeitung.“
Genexpression führt zu beeinträchtigten Hirnfunktionen
An der Studie unter der Leitung der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität München waren zudem Forscher des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München, des Instituts für Humangenetik der Universität Bonn und Life and Brain Zentrum in Bonn sowie der Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitäten Marburg und Würzburg beteiligt.
Die Wissenschaftler konnten darin zeigen, dass ein direkter funktionaler Zusammenhang zwischen Genexpression und beeinträchtigten Hirnfunktionen bei der Legasthenie besteht.
Auf der Suche nach biologischen Markern für die Früherkennung
Das Forscherteam wird nun in weiteren Studien untersuchen, ob anhand biologischer Marker Kinder mit einer Legasthenie bereits früher erkannt werden können, bevor die leidvolle Entwicklung vieler Kinder mit einer Legasthenie stattgefunden hat.
„Vor allem die Möglichkeit der Prävention und der frühen Intervention sind für uns von zentraler Bedeutung für zukünftige Forschungsvorhaben“, sagt Schulte-Körne.
(idw – Klinikum der Universität München, 30.09.2009 – DLO)