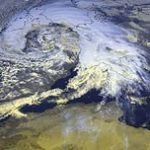Strahlung aus Fleisch und Gemüse: Die Lebensmittel in Japan waren nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima stark radioaktiv kontaminiert, wie eine systematische Analyse nun bestätigt. Trotzdem war die japanische Bevölkerung dadurch nur wenig gefährdet, weil die Behörden die verseuchte Nahrung größtenteils rechtzeitig vom Markt nahmen, wie die Forscher berichten.
Bei der Reaktorkatastrophe von Fukushima am 11. März 2011 gelangten große Mengen radioaktiven Materials in die Atmosphäre und verteilten sich im Umland. Die japanischen Behörden evakuierten eine Sperrzone im Umkreis von 20 Kilometern um das havarierte Kraftwerk Fukushima Daiichi. In ganz Japan überwachten sie Radioaktivitätswerte, insbesondere von Lebensmitteln. Denn auf diesem Weg gelangt radioaktiv verseuchtes Material am leichtesten in den menschlichen Körper, wo es besonders großen Schaden anrichten kann.
Zeitlicher Verlauf bei Fleisch und Gemüse
Die Messergebnisse von seit der Katastrophe gesammelten über 900.000 Lebensmittelproben machten die Behörden online zugänglich. „Die Bemühungen der japanischen Behörden waren gigantisch und im Wesentlichen auch sehr erfolgreich“, sagt Georg Steinhauser von der Technischen Universität (TU) Wien. Steinhauser hat zusammen mit seinen Kollegen anhand dieser Datenfülle erstmals analysiert, wo und wie sich Radioaktivität in Lebensmitteln nach einer Reaktorkatastrophe wie in Fukushima besonders konzentriert. Besonderes Augenmerk legten die Forscher auf die gemessenen Mengen des radioaktiven Isotops Cäsium-137.
Dabei zeigten sich auffallende Unterschiede: Bei tierischen Produkten erwies sich die radioaktive Belastung direkt nach dem Reaktorunglück als relativ gering. Im Laufe einiger Monate stieg sie jedoch stark an: Im Frühsommer 2011 lag sie jenseits der gesetzlichen Grenzwerte. Das liegt daran, dass es eine Weile dauert, bis ein Tier größere Mengen an Cäsium aufgenommen und im Körper eingelagert hat.
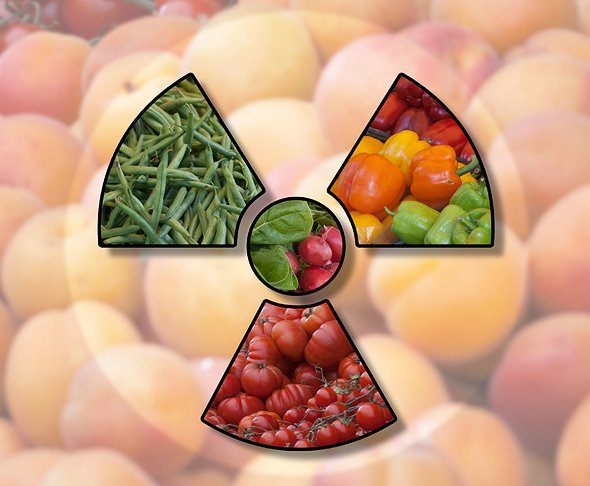
Pilze treiben Werte nach oben
Ganz anders ist die Situation bei Gemüse: Hier war die Belastung bereits direkt nach dem Unfall sehr hoch, wie die Forscher berichten. Innerhalb eines Monats fielen die gemessenen Werte dann auf ein Zehntel, und lagen nach vier Monaten wieder unterhalb der Grenzwerte. Das meiste radioaktiv verseuchte Gemüse kam jedoch nie auf den Markt, da die Behörden den Verkauf von Lebensmitteln aus dem betroffenen Gebiet rechtzeitig gesperrt hatten.
„Interessant ist, dass einen weiteren Monat später, im August 2011, die Maximalwerte wieder stiegen“, berichtet Georg Steinhauser. „Die Pilzsaison hatte begonnen, und Pilze sind bekannt dafür, Cäsium gut zu speichern.“ Dieser Effekt ging bald wieder zurück, Mitte November 2011 allerdings waren noch einmal erhöhte Werte zu finden: Zu diesem Zeitpunkt waren die getrockneten Pilze verkaufsfertig.
Geringe Belastung durch Lebensmittel
Die Radioaktivität im Trinkwasser untersuchten die Wissenschaftler ebenfalls, es erwies sich aber als nur sehr gering belastet. Die Forscher urteilen optimistisch über die Belastung der Lebensmittel, die für die Bevölkerung entstand: „Die Zahl der Personen, die aufgrund des Reaktorunglücks von Fukushima mehr als das erlaubte Millisievert pro Jahr mit der Nahrung aufgenommen haben, dürfte sehr gering gewesen sein“, sagt Steinhauser. „Solche Überschreitungen dürften fast ausschließlich bei Personen vorgekommen sein, die selbst im Garten Lebensmittel angebaut oder Pilze gesammelt haben und somit die behördlichen Vorsichtsmaßnahmen umgingen.“
In der Präfektur Fukushima überschritten im ersten Jahr nach der Katastrophe 3,3 Prozent der Lebensmittelproben die Grenzwerte, in ganz Japan waren es 0,9 Prozent. Drei Jahre später, im Zeitraum von April bis August 2014, waren es nur noch 0,6 beziehungsweise 0,2 Prozent. „Das sind allesamt relativ niedrige Prozentsätze“, meint Georg Steinhauser.
Strontium nicht länger ignorieren
Die Wissenschaftler der TU empfehlen den japanischen Strahlenschutzexperten jedoch eine wichtige Erweiterung ihrer Messungen: Sie sollten sich nicht auf Cäsium-137 konzentrieren, sondern auch das Isotop Strontium-90 mit einbeziehen. Diese beiden radioaktiven Zerfallsprodukte treten zwar immer gemeinsam auf, so dass nach einem Reaktorunfall zunächst die Messung von Cäsium-137 ausreicht, um das Risiko abzuschätzen.
Längerfristig unterscheiden sich jedoch die Zerfallszeiten und das Verhalten in der Natur. Strontium ähnelt chemisch dem Calcium und wird daher besonders leicht von Organismen aufgenommen und zum Beispiel in den Knochen eingelagert. „Strontium-90 ist ein besonders schwierig nachzuweisendes Radionuklid, es wurde bisher von den Behörden ignoriert“, sagt Steinhauser. Indem die japanischen Behörden weiterhin lediglich Cäsium-137 messen, könnten sie die Belastung durch Strontium-90 daher unterschätzen. (Environmental Science & Technology, 2015; doi: 10.1021/es5057648)
(TU Wien, 04.02.2015 – AKR)