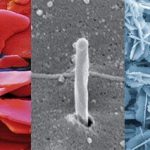Plastikmüll und kein Ende in Sicht: Wenn nichts unternommen wird, erhöht sich bis zum Jahr 2030 die in Deutschland eingesetzte Kunststoffmenge um fast ein Drittel. Das belegt eine von der Umweltorganisation NABU beauftragte Studie. Doch es gäbe Auswege aus der Plastikflut, wie die Forscher darlegen. Allerdings: Ohne staatlichen Nachdruck werden sie kaum umgesetzt werden.
Plastikmüll ist längst zu einem weltweiten Problem geworden: Jedes Jahr gelangen rund acht Millionen Tonnen Plastikmüll von unseren Küsten aus in die Ozeane. Kunststoffpartikel finden sich selbst in der Tiefsee und weit entfernt von jeder Zivilisation. Mikroplastik kontaminiert aber schon unsere Getränke und sogar Honig.
Aus diesem Anlass hat die Umweltorganisation NABU das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie beauftragt, abzuschätzen, welche zusätzlichen Mengen an Kunststoffen zukünftig (bis 2030) in Deutschland zu erwarten sind – und auch, welche Auswege es aus der scheinbar unvermeidlichen Plastikflut geben könnte.
Das Ergebnis: Wenn nichts unternommen wird, wird sich bis zum Jahr 2030 die in Deutschland eingesetzte Kunststoffmenge um fast ein Drittel erhöhen. Im Umlauf wären dann 12.227 Kilotonnen statt wie heute 9.585 Kilotonnen Plastik, wie die Forscher ermittelten. Der Grund dafür ist eine stetige Zunahme vor allem bei den Verpackungen und in der Baubranche.
„Die Studie zeigt, dass niedrige Preise für Erdöl und immer mehr Anwendungsgebiete die Nachfrage nach Kunststoffen steigern werden, so dass der Markt aus rein ökonomischen Gründen nicht auf Plastik verzichten wird“, so NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Global wächst der Markt für Kunststoff zurzeit jedes Jahr um 8,5 Prozent, wie die Studie darlegt.
Es gibt Gegenmaßnahmen
Doch die Forscher zeigen auch, dass dieser Trend gestoppt werden kann – wenn Politik, Wirtschaft und Verbraucher sich entsprechend engagieren. So lassen sich einige erdölbasierte Kunststoffe heute bereits durch biobasierte Stoffe ersetzen – sogar aus Milch lassen sich Polymere herstellen, wie die Forscher erklären. Ein verstärktes Recycling und Einsparungen bei der Kunststoffherstellung könnten ebenfalls dazu beitragen, die Menge des Plastikabfalls zu senken.
Eine zentrale Rolle sehen die Forscher aber auch im Handel – und beim Konsumenten. So könnten Mehrweg-Verpackung oder wiederverwendbare Transportbehälter den Verpackungsmüll begrenzen. Dünnere Plastikfolien oder ganz unverpackte Ware im Supermarkt tragen ebenfalls dazu bei. Ein Beispiel ist Der Supermarkt „Original Unverpackt“, der komplett auf Einwegverpackungen verzichtet. Ähnliche Initiativen gibt es auch in einigen anderen Städten. Bei plastikhaltigen Geräten oder anderen Produkten wären Reparatur statt Wegwerfen und Neukaufen sinnvoll. Würde all das umgesetzt, ließen sich bis 2030 sogar 80m Prozent des Plastiks einsparen.
..aber der Staat muss dabei nachhelfen
Doch das Ganze hat einen Haken, wie die Forscher aufzeigen: Bisher fehlen für die meisten dieser Maßnahmen die Anreize – sie sind vielen Unternehmen zu teuer, noch zu umständlich oder in größerem Maßstab noch nicht umsetzbar. „Hier muss der Staat seine Verantwortung wahrnehmen und gegensteuern, indem er den Ressourcenverbrauch besteuert und Vorgaben zum Ökodesign von Kunststoffprodukten macht“, meint NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Der Staat müsse aber auch mit gutem Beispiel vorangehen, indem er selbst durch eine kunststoffarme öffentliche Beschaffung zur Verringerung beiträgt und Branchenprozesse für Vermeidungslösungen anstößt.
„Deutschland wird auch in den nächsten fünfzehn Jahren nicht plastikfrei werden. Aber es ist zumindest möglich, die Plastikflut einzudämmen“, sagt NABU-Leiter Ressourcenpolitik Benjamin Bongardt. Der Weg zu weniger Kunststoffverbrauch führe über gesetzliche Regelungen, die Ressourcenverschwendung über Sonderabgaben unrentabel machen, ein Umdenken in der Wirtschaft zu nachhaltigen Produktionen sowie über den Druck der Verbraucher, die über bewusste Kaufentscheidungen den Handel zu weniger Einsatz von Kunststoffverpackungen bewegen.
Mehr Informationen finden Sie auf der NABU-Seite zur Studie.
(NABU, 16.04.2015 – NPO)