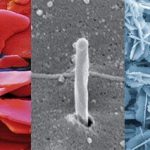„Wir appellieren an die Brauereien, ihre Produkte und Zutaten jetzt genau zu überprüfen. Sie müssen klären, wie Glyphosat in das Bier gelangen konnte und in Zukunft sicherstellen, dass ihre Produkte frei von Pestizidrückständen sind“, sagt Guttenberger.

Diese Biere hat das Umweltinstitut auf Glyphosat getestet - alle waren positiv. © Umweltinstitut München/ Samuel Schlagintweit
Trinkwasser-Vergleich unredlich?
Die Veröffentlichung dieser Ergebnisse sorgte für heftige Reaktionen. Der Industrieverband Agrar sprach von einer „Angstkampagne auf unterstem Niveau“. Er sieht den Vergleich mit den Trinkwasser-Grenzwerten als unseriös an: „Natürlich ist Bier kein Trinkwasser, sondern ein alkoholhaltiges Genussmittel“, heißt es in einer Stellungnahme.
Ähnlich sieht es die Arbeitsgemeinschaft Glyphosat, die die Hersteller des Pestizids vertritt. Sie argumentiert, dass Bier ja auch einen weiteren krebserregenden Stoff enthält, an dem sich offenbar niemand stößt: Alkohol. Er rangiere in der Klassifikation des Krebsinstituts der WHO sogar eine Klasse weiter oben als Glyphosat und sei damit „sicher krebserregend“. Demgegenüber betont das Umweltinstitut, dass gerade die Summierung verschiedener Schadstoffe und Umweltgifte in unserer Ernährung eine größtmögliche Reduzierung vermeidbarer Belastungen erfordern.
Kommt es auf die Menge an?
Ein weiterer Hauptpunkt der Kritik: Die gefundenen Glyphosatmengen seien viel zu gering, um gesundheitliche Schäden zu verursachen, heißt es. Sogar das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) schrieb in einer Stellungnahme: „Um gesundheitlich bedenkliche Mengen von Glyphosat aufzunehmen, müsste ein Erwachsener an einem Tag rund 1.000 Liter Bier trinken. Glyphosatgehalte von 30 Mikrogramm pro Liter Bier stellen nach dem derzeitigen Stand des Wissens kein gesundheitliches Risiko dar.“
Darauf kontert nun Karl Bär, Referent für Agrarpolitik beim Umweltinstitut München: „Wenn ein Stoff mit hoher Wahrscheinlichkeit krebserregend ist, haben auch geringe Mengen bereits das Potenzial, Schaden anzurichten. Eine sichere tägliche Aufnahmedosis kann dann nicht benannt werden.“ Es sei daher durchaus legitim, selbst bei geringen Mengen Alarm zu schlagen.
BfR-Kritik nicht objektiv?
Hinzu kommt, dass das BfR in puncto Glyphosat nicht ganz unvoreingenommen ist. Denn diese Behörde kam bereits früher zu dem Schluss, dass Glyphosat nicht schädlich sei – und gab auch eine entsprechende Empfehlung an die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) weiter.
Das wiederum führte dazu, dass eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern einen offenen Brief an die EU schickte, in dem sie die Position des BfR kritisieren: „Wir haben diese beiden unterschiedlichen Urteile über die krebserregende Wirkung von Glyphosat bei Menschen untersucht und kommen zu dem Ergebnis, dass das Urteil der Arbeitsgruppe der IARC bei weitem glaubwürdiger ist.“
„Es ist erschreckend, dass ausgerechnet eine für Verbraucherschutz zuständige Bundesbehörde die Gefahren von Glyphosat herunterspielt“, kommentiert Bär. Als Folge kam auch sie jüngst zur Einschätzung, dass das Herbizid wahrscheinlich nicht krebserregend sei.
Brauereien wollen besser prüfen
Aber es gibt auch gute Nachrichten: Einige Brauereien haben bereits angekündigt, dass sie in Zukunft ihre eigenen Biere genauer testen lassen wollen und beim Kauf von Rohstoffen in Zukunft noch genauer hinsehen. Das gemeinsame Ziel von Verbraucherschützern und Brauereien sollten saubere, gut und fair produzierte Lebensmittel sein.
Die Bitburger Brauerei erklärte zudem: „Demnächst entscheidet die EU-Kommission über die Verlängerung der Zulassung von Glyphosat in der Landwirtschaft um weitere 15 Jahre. Wir hoffen, dass die Politiker eine Entscheidung im Sinne der Verbraucher in Europa treffen werden.“
Das Hintergrundpapier mit den Testergebnissen zum Download (PDF)
(Umweltinstitut München, BfR, Arbeitsgemeinschaft Glyphosat, Industrieverband Agrar, 26.02.2016 – NPO)
26. Februar 2016